




Text: Nadine Trautzsch
Bild: Nadine Trautzsch/Dall-E, 2024

Traditionelle Geschichten geben ihren Verlauf unveränderlich linear vor. Das Genre der Interactive Fiction schafft dagegen eine dynamische Erfahrung, die den Leser herausfordert und als bewussten Gestalter in das Geschehen einbindet. Dazu gibt es ein theoretisches Konzept aus der Literaturwissenschaft: Der Begriff „Ergodische Literatur“ bezeichnet Texte, deren vollständiges Verständnis und Erleben ein aktives Engagement und teils auch physische Interaktion der Lesenden erfordert. Der Begriff geht auf den Theoretiker Espen Aarseth zurück, der in seinem Werk „Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature“ (1997) ergodische Literatur als Texte beschreibt, die „nichtlinear oder multifunktional“ sind und bei denen das Navigieren durch den Text ein bewusster und aktiver Akt seitens der Lesenden ist. Die Struktur dieser Texte verlangt, dass der oder die Lesende Entscheidungen trifft oder Eingaben macht, um im Text voranzukommen, und weicht damit vom traditionellen, linearen Lesevorgang ab (Aarseth, 1997).
Die Ursprünge der Interactive Fiction liegen einerseits in experimenteller Literatur und andererseits in den frühen Computer- und Videospielen der 1970er Jahre. Auf literarischer Seite legten Werke wie Jorge Luis Borges’ "Der Garten der Pfade, die sich verzweigen" (1941) erste Grundlagen für verzweigte Erzählstrukturen. Auch die Reihe „Choose Your Own Adventure“, bei denen Leser:innen Pfade durch verschiedene Entscheidungen wählen, zählen zu ergodischer Literatur. Das literarische Genre teilt damit Konzepte mit interaktiven Medien und Computerspielen, die ebenfalls eine aktive Teilnahme der Rezipierenden erfordern und oft nicht-lineare Erzählstrukturen aufweisen. Bekannt sind auch die Veröffentlichungen der Dungeon & Dragons-Solo Adventure-Reihe, zu der immer mehr neue Geschichten, Karten und Adventures von freien Autoren entwickelt und verkauft werden. Im Genre des Computerspiels finden wir später im Verlauf der Geschichte diese Konzepte in Hypertexten, MUDS, Textadventures wieder.
Will Crowther entwickelte 1976 das textbasierte Computerspiel Colossal Cave Adventure (auch einfach Adventure genannt), das als erstes interaktives Textabenteuer gilt. Es führte das Prinzip ein, mit getippten Befehlen (z. B. "Go north") eine Geschichte voranzutreiben und auf Spieleraktionen zu reagieren. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren entstand daraus eine lebhafte Szene, zu der insbesondere Infocom mit Titeln wie Zork (1980) beitrug und den Begriff "Interactive Fiction" (IF) prägte. Diese frühen Textadventures legten das Fundament für das heutige Verständnis von IF, das vom reinen Textparser-Spiel bis hin zu multimedialen, interaktiven Narrationen reicht. Interessant sind auch Werke wie „House of Leaves“ von Mark Z. Danielewski, das zunächst als „Hypertext“ im Internet erschien, und das im Jahr 2000 als Buch veröffentlicht durch typografische Experimente und alternative Seitenlayouts die Lesenden dazu zwingt, Textfragmente und Fußnoten in bestimmter Reihenfolge zu lesen oder umzublättern, um den Inhalt zu entschlüsseln.
Montfort zählt in seinem Werk „Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction“ über die Interactive Fiction Formate folgende Genre, Darstellungsästhetiken und Mechaniken auf: „Viele verschiedene Formen werden sinnvollerweise als 'Computerliteratur' oder 'elektronische Literatur' diskutiert: MUDs und MOOs, Hypertext-Fiction, automatische Geschichten- und Gedichtgeneratoren und Konversationsprogramme (auch Chatterbots genannt), um nur einige zu nennen. Viele verschiedene Arten von Cybertexten, ob elektronisch oder nicht, präsentieren unterschiedliche Texte, die je nach den Handlungen des Lesers zu lesen sind" (Montfort, 2015).
Interactive Fiction zeichnet sich also konkret durch den Aspekt des narrativen Mitgestaltungspotenzials aus: Der Leser oder Spieler wird zum aktiven Teilnehmer, der die Handlung durch Entscheidungen beeinflusst und so die eigene Geschichte formt. Diese interaktive Dimension fordert und fördert das kreative Denken und die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer und lädt dazu ein, narrative Probleme zu lösen und Handlungsstränge kritisch zu hinterfragen. Interactive Fiction stellt somit eine wertvolle Bildungsressource dar, die Kinder, Jugendliche und neugierige Erwachsene dabei unterstützt, ihre schöpferischen Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen. Die Perspektivübernahme von Figuren und Kulturen, die unterschiedliche Lebensrealitäten repräsentieren, kann das empathische Verständnis und die soziale Kompetenz stärken. Spieler werden direkt mit den emotionalen und moralischen Dilemmata der Figuren konfrontiert. Solche Erfahrungen tragen dazu bei, ein kulturelles Bewusstsein zu entwickeln und sich offen mit der Vielfalt und Komplexität menschlicher Beziehungen auseinanderzusetzen. Laut dem Medienpädagogen Henry Jenkins ermöglichen interaktive Erzählformate jungen Menschen, Medien nicht nur als Konsumenten, sondern als Produzenten und Mitgestalter zu verstehen, und somit ihre Selbstwirksamkeit und Kreativität zu fördern (Jenkins, 2009).
Einerseits stärkt IF die Kompetenzen der kritischen Reflexion und des Einfühlungsvermögens (Empathie) und andererseits fördert es Entscheidungskompetenzen und Kompetenzen im Hinblick auf Zusammenhänge und Ergebnisse. Somit unterstützt IF Kinder und Jugendliche den individuellen und gesellschaftlichen Anforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden.
Die gestalterische Dimension von Interactive Fiction und KI -Systemen
Wie bereits beschrieben, kann Interactive Fiction durch die Dualität von Autorenschaft und Interpretation die Schöpferische Freiheit und Eigenverantwortung der Spieler unterstützen. Diese Art von digitaler Literatur oder interaktiver Erzählung im digitalen „Raum“ (Montfort, 2003) ist eine dynamische, spielbare Erzählwelt, in der sich Simulation und Narration auf diegetischen Ebenen überlagern. In seinem Essay „Riddle Machines: The History and Nature of Interactive Fiction” (Siemens, Schreibman, 2008) schreibt Montfort: „If interactive fiction were simply a riff on the command-line way of interacting with computers, it would be of little interest. But it has been more than that for decades, providing a fascinating structure for narrative human—computer conversation, bringing simulation and narration together in novel ways.” Weiter schlägt er eine weitere literarische Form vor, eine poetische Form des Rätsels: „Indem sie den Zuhörer oder Leser auffordern, sie mit einer Antwort zu vervollständigen, regen Rätsel zum Nachdenken und zur Diskussion an, was bei vielen anderen literarischen Formen nicht der Fall ist, bei interaktiver Fiktion jedoch schon. So wie ein echtes Rätsel eine Antwort verlangt, erfordert interaktive Fiktion Input vom Interaktor. Sie bietet dem Interaktor auch oft die Möglichkeit, sein Verständnis der IF-Welt zur Schau zu stellen: Indem der Spielercharakter angemessen handelt, zeigt der Interaktor, dass er die seltsamen Systeme eines bestimmten Werks verstanden hat. Das Rätsel hilft zu erklären, wie in der interaktiven Fiktion eine Figuration und eine Aushandlung des Verständnisses stattfinden kann.“
IF fördert die Beschäftigung mit Erzählformen und die Freude, die Erzählung nachzuempfinden und weiterzuerzählen. Und fördert somit auch das kreative und selbstbestimmte Denken, indem sie den Nutzer in eine aktive Rolle als Mitschöpfer des narrativen Prozesses einbindet (Montfort, 2003). Laut Janet Murray, einer Pionierin auf dem Gebiet digitaler Narration, zeichnet sich IF durch ein einzigartiges Zusammenspiel von Storytelling und Interaktivität aus, das eine "partizipative Ästhetik" schafft, die Leser und Spieler dazu befähigt, über die herkömmliche Rezeption hinauszugehen und die narrative Struktur zu beeinflussen. Spieler werden zu Mitschöpfern der Geschichte und lernen, narrative Strukturen zu entwerfen und zu verstehen. Ebenso beschreibt Janet Murray in „Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace (2017)“ das Konzept der Agency als ein zentrales Merkmal interaktiver Medien. Für Murray bedeutet Agency die Fähigkeit der Spieler:innen oder Nutzer:innen, in einer virtuellen Umgebung bedeutungsvolle Entscheidungen zu treffen und deren Auswirkungen innerhalb der Geschichte oder des Systems zu erleben. Es ist das Gefühl, selbstbestimmt zu handeln und mit den Entscheidungsmöglichkeiten im Medium tatsächliche Konsequenzen für die Handlung zu erzeugen. Agency entsteht, wenn die Handlungen der Spieler:innen nicht nur möglich, sondern auch sinnstiftend und kohärent in die narrative Struktur eingebettet sind. Diese sinnstiftende Wahlmöglichkeit unterscheidet Agency von bloßer Interaktivität; es geht nicht nur darum, dass Spielende irgendetwas tun können, sondern dass ihre Entscheidungen relevant sind und eine narrative Konsequenz haben, die das Erlebnis formt und bereichert (Murray, 2017): “When the things we do bring tangible results, we experience the second characteristic delight of electronic environments— the sense of agency. Agency is the satisfying power to take meaningful action and see the results of our decisions and choices” (Murray, 2017, S. 159).
Weiter beschreibt Janet Murray mit dem von ihr geprägten Begriff "multiform stories" (oder auch "Multiform Narrative") Erzählungen, die in mehreren Varianten existieren oder aus mehreren Perspektiven erzählt werden. Anstatt eine Geschichte linear von Anfang bis Ende zu durchlaufen, ermöglichen „multiform stories“ unterschiedliche Handlungsverläufe, alternative Wendungen oder parallele Erzählebenen. Dadurch kann ein einzelnes narratives Werk verschiedene Ausgänge, Perspektiven oder „Versionen“ der gleichen Grundgeschichte umfassen. Für die Leserinnen oder Spielerinnen bedeutet das, dass sie ein Werk immer wieder neu erfahren können, da jede Interaktion oder jede ausgewählte Variante eine andere Facette der Geschichte aufdeckt. Murray zeigt damit das Potenzial digitaler Medien auf, Erzählungen so zu strukturieren, dass sie vielfältige Wege und Deutungen ermöglichen und somit über das rein Lineare hinauswachsen. Diese Form von Nicht-Linearität und Offenheit betrachtet sie als einen wesentlichen Schritt hin zu interaktiven und immersiven Erzählformen.
Auch der bereits erwähnte Neurowissenschaftler Karl Friston, der uns verrät, was menschliche Intelligenz ist, beschreibt die „Agency“ als Teil der menschlichen Intelligenz die von „Neugier getrieben, zur Selbstevidenz und somit Selbstwirksamkeitserfahrung“ führt. (Friston, 2024)
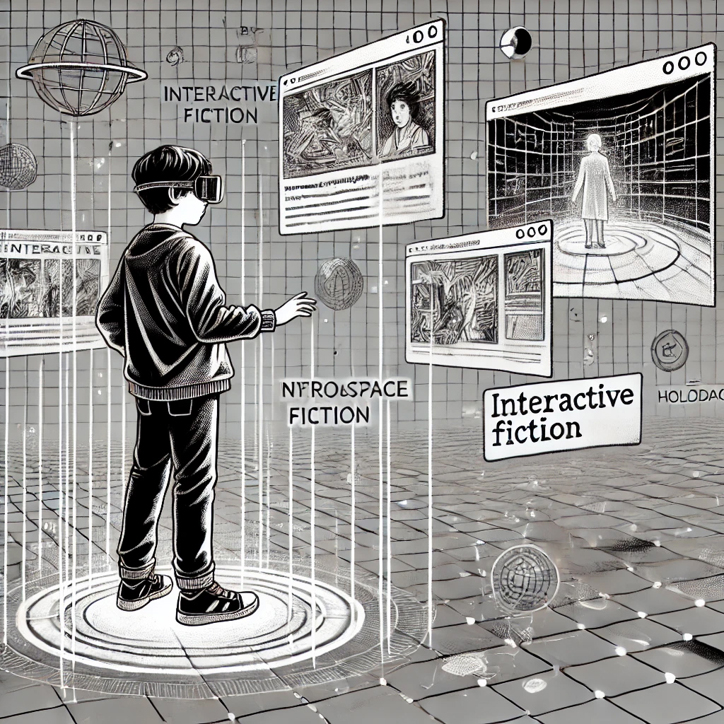
Bild: Trautzsch, 2024 Ein Bild zum Thema Interactive Fiction - Digital, Cyberspace, Holodeck. Dall-E, 2024.
Murray hebt hervor, dass „Agency“ eine Illusion von Kontrolle und Einfluss schafft, die es den Nutzer:innen ermöglicht, sich als aktive Teilnehmende der erzählten Welt zu fühlen. Diese Vorstellung bezieht sich darauf, wie digitale Welten immersiv gestaltet werden können, sodass Spielende nicht nur passive Beobachtende sind, sondern die Erzählung aktiv durch ihre Handlungen mitgestalten. „Agency“ wird so zu einem Kernkonzept für interaktive Erzählungen und Computerspiele, in denen die Spieler:innen durch ihre Entscheidungen und Handlungen narrative Bedeutungen schaffen und die Entwicklung der Geschichte beeinflussen können. Die kreative Freiheit, das kreative Potenzial (Burbach, Trautzsch, 2025) in IF zeigt sich besonders darin, dass der Spieler die Macht über die Entwicklung und den Ausgang der Geschichte erhält, was die Fantasie anregt und zur aktiven Auseinandersetzung mit der Erzählstruktur führt. Diese Erfahrung der Eigenverantwortung und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, machen IF zu einem besonders wertvollen Instrument, um Kreativität und Selbstwirksamkeit zu fördern.
Das Spiel "80 Days" von Inkle Studios (2014) beispielsweise erlaubt Spielern, die Reise eines Charakters zu gestalten, der die Welt umreist, wobei jeder Entscheidungspunkt eine Vielzahl von Handlungssträngen eröffnet. In diesem Prozess lernen Spieler, narrative Elemente nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv zu gestalten und verschiedene Erzählmöglichkeiten zu erkunden.
Durch die Interaktivität des Genres wird gleichsam das „erfinderische Denken“ geschult, wie es die Medienpädagogin Bettina Uhlig in ihrem 2015 erschienenen Text über „Sinnkonstituierende Lernprozesse“ bezeichnet. Uhlig beschreibt im Medium der Bildgebenden Form eine Art der Gestaltung von „Räumen“, die den Möglichkeitsraum für die Imagination der Rezepient:innen öffnet, ganz ähnlich der „Leerstellen“-Theorie von Wolfgang Iser, der diese 1972 in der Literaturwissenschaft beschrieb. Das pädagogische Konzept des erfinderischen Denkens ermöglicht es Lernenden, durch kreative Interaktion mit Kunstwerken ihre eigene Kreativität zu entfalten und innovative Denkprozesse zu entwickeln.
Mittels Interactive Fiction und vor allem aus der Sicht der Autorenrolle oder „Agency“ entwickeln Spieler:innen eine Form der Kreativität, die sich aus dem Erforschen und Kombinieren von narrativen Möglichkeiten ergibt. In ihren Publikationen betont Uhlig die Bedeutung von Kreativität und Imagination als zentrale Elemente im Bildungsprozess. Die Auseinandersetzung mit Bildern (und Geschichten) kann sinnstiftende Lernprozesse initiieren (Uhlig, 2015). Somit werden im Genre Interactive Fiction didaktische Methoden angewandt, das Genre stellt damit nicht nur eine Freizeitbeschäftigung dar, sondern auch eine tiefgreifende Möglichkeit, individuelle Ausdrucksformen zu finden und die Fähigkeit zur kreativen Problemlösung zu fördern.
Autor:innen, Schriftsteller:innen, Kreative arbeiten zumeist, bewusst oder unbewusst, in einer reflektiven Praxis (Schön, 1984). Über das Wissen der Praktiker schreibt etwa der Soziologe Donald Schön in seiner Publikation „The Reflective Practitioner“ (1983). Sie ist bis heute für die Designforschung wegweisend. Schön skizziert darin eine Epistemologie (Erkenntnistheorie) der Praxis und beschreibt, wie Designer professionelle Probleme mit Hilfe ihres praktischen Erfahrungswissens lösen. Er spricht vom impliziten (taciten) Wissen der Praxis: „The best professionals know more than they can put in words“ und schlägt vor, Design als „reflective conversation with the situation“ zu betrachten (Schön, 1983, S. 76).
Das heißt Praktiker:innen nutzen einen inneren oder externen Gesprächs-, ja Reflexions-Partner, der ihnen ihre Arbeiten, Denkweisen, Texte im Dialog reflektiert oder Feedback erstellt. Oder einen inneren Partner – eine Art inneren Monolog und Perspektivwechsel hin zum Rezipienten, der Gedanken, Sätze, Texte, Bilder und deren Repräsentationen einordnet und bewertet. Davon ausgehend werden Entscheidungen zur weiteren Gestaltung getroffen oder Bestehendes weiterentwickelt. Insofern können KI-Systeme, die menschenähnliche Fähigkeiten wie Lernen, Problemlösen, Wahrnehmen und Sprachverarbeitung nachahmen können (Russell & Norvig, 2021), als Werkzeug eingesetzt werden.
Wenn wir KI als Werkzeug verstehen, das kreative Prozesse erweitert, reiht sie sich ein in eine lange Tradition technischer Entwicklungen, die das künstlerische Schaffen geprägt und neugestaltet haben. Ähnlich wie die Fotografie das Zeichnen und Malen beeinflusst hat oder digitale Bearbeitungstools wie Photoshop die Dunkelkammer abgelöst haben, ermöglicht KI nun neue kreative Wege und erweitert den künstlerischen Ausdruck.
Somit lässt sich KI als das neueste Werkzeug in einem langen Prozess der Transformation sehen, das den kreativen Prozess zugänglicher und vielseitiger macht. Wie alle Werkzeuge verlangt auch KI Kenntnisse und sensiblen Umgang seitens des Künstlers, um sicherzustellen, dass die maschinelle Arbeit keine ungewollten Effekte oder Bedeutungen erzeugt. In diesem Sinne könnte KI nicht als Ersatz für die menschliche Kreativität, sondern als Bereicherung betrachtet werden, die, richtig eingesetzt, neue kreative Wege eröffnet und die traditionelle Kunstpraxis in einer digitalisierten Welt ergänzt.
Die Idee eines Roboters, der den Menschen in seiner kreativen, erschaffenden, gestalterischen Arbeit unterstützt, ist nicht neu. In den 1930er-Jahren blüht die Pulp-Fiction-„Schundliteratur“ und Autor:innen müssen oft über Nacht actiongeladene Geschichten liefern. Um schnell und zuverlässig Plots zu entwickeln, greifen sie auf sogenannte Story-Plotter zurück – Hilfsmittel, die Handlungsgerüste und Konfliktsituationen liefern. George Polti klassifiziert in seinen „36 Dramatischen Situationen“ die Grundformen aller möglichen Konflikte, was eine heftige Debatte über die Vereinbarkeit von Kreativität und Systematik auslöste. William Wallace Cook liefert mit „Plotto“ ein praktisches Nachschlagewerk unzähliger Konfliktsituationen, während Wycliffe A. Hill mit seinem „Plot Genie“ sogar Zufallselemente nutzt, um neue Story-Ideen zu generieren. „Mithilfe des Plot Genie muss man nicht auf einen seltenen Geistesblitz für eine Geschichte warten. Der „Plot Genie-Roboter“ liefert alle fünf Minuten ein komplettes Handlungsgerüst, und ich kann jedem Autor zeigen, wo er die Handlungsstruktur jeder Geschichte hätte entwickeln können, die er je geschrieben hat.“ – so stellte Hill 1931 seinen „Roboter vor (The Bold Venture Press). „Der Plot Robot war ein Papprad. Durch ein winziges ausgeschnittenes Fenster in der Kristallkugelillustration waren Zufallszahlen sichtbar. Jedes Plot Genie“-Buch enthält eine „Formel“ mit durchschnittlich neun Schritten zum Aufbau der Handlung. Notieren Sie Ihre Zufallszahlen in jedem Feld und konsultieren Sie dann die entsprechenden Seiten, um die Handlungsstruktur Ihrer Geschichte zu bestimmen“ (Pulp, 2021).
Insofern sind KI-Systeme diese Art „Roboter“, die im Dialog unsere Gedanken ordnen können, neue Sichtweisen eröffnen oder komplexe Strukturen zusammenfassen. Hiermit ergibt sich ein breites Spielfeld für interaktive Anwendungen und auch für das Genre der Interactive Fiction. Verbinden wir also Handlungsspielraum, Entscheidungsmöglichkeit und den „Roboter“ in Form von KI als Werkzeug für eigene Ideen, Experimente und Erzählstrukturen, so entfaltet sich eine neue gestalterische Dimensionen für Interactive Fiction Formate und für den Rezipient:innen und Autor:innen.
Doch wie genau kann Interactive Fiction über die narrative Gestaltung hinaus zur Ausbildung kognitiver und analytischer Fähigkeiten beitragen und in Lernprozessen Anwendung finden?
Durch interaktive, multiperspektivische Herausforderungen bietet das Genre eine wertvolle Plattform zur Entwicklung von Problemlösungsfähigkeiten. Diese Spiele und Geschichten verlangen von den Spielern nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern auch analytische und strategische Denkfähigkeiten zu nutzen, um verschiedene narrative Pfade zu erkunden und Herausforderungen zu meistern. Laut der Medienforscherin Marie-Laure Ryan ist das immersive und interaktive Element von IF ein bedeutender Vorteil, da es die Leser:innen zu „aktiven Teilnehmern im Geschichtenraum“ macht und sie zwingt, Handlungsmuster kritisch zu hinterfragen und kreative Lösungsansätze zu entwickeln.
Spieler müssen im Genre komplexe Szenarien und Rätsel lösen, die kreatives Denken und strategisches Handeln oder logische Entscheidungen erfordern, um weiterzukommen.
Wissenstransfer, Erkundung und Kombination von Informationen sind notwendig, um die Herausforderungen zu meistern. Es müssen Hinweise und Informationen gesammelt und strategisch genutzt werden, um die Geschichte voranzutreiben.
In dem bereits erwähnten reinen Textadventure-Spiel Zork (1980), einem Klassiker der Interactive Fiction, erkunden die Spieler eine textbasierte Welt voller Rätsel, die gelöst werden müssen, um voranzukommen. Diese Art der Rätsellösung ist nicht nur unterhaltsam, sondern fördert nachweislich das logische Denken und die Fähigkeit, verschiedene Ansätze zur Problemlösung zu kombinieren (Montfort, 2003). Solche Herausforderungen erfordern von den Spielern, systematisch vorzugehen und sich dabei kognitiv flexibel zu verhalten, um auf neue Informationen reagieren zu können – eine zentrale Fähigkeit zur Lösung komplexer Probleme in der realen Welt.
In einer Studie zur Rolle von Spielen bei der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten fand James Paul Gee heraus, dass solche interaktiven und problemlösungsorientierten Formate entscheidend für die Ausbildung der „situativen Intelligenz“ sind, da sie den Spielern beibringen, Informationen zu verknüpfen, kontextbezogen zu denken und kreative Wege zu finden, um Ziele zu erreichen (Gee, 2014): „In a video game, you press some buttons in the real world and a whole interactive virtual world comes to life. Amplification of input is highly motivating for learning.“ Diese Fähigkeiten lassen sich direkt auf das reale Leben übertragen, da sie den kognitiven Prozess des Problemlösens fördern und die Spieler ermutigen, in komplexen Situationen methodisch vorzugehen.
Es gibt nicht für jede Problemsituation eine „richtige“ oder „falsche“ Lösung. Spieler lernen, dass problemorientiertes Denken notwendig ist, um das Spiel voranzubringen. Diese Ansätze nutzen immer mehr Triple-A Spieleveröffentlichungen, mit komplexem RPG Game Play und hyperrealistischen Darstellungsästhetiken. Als „AAA“ oder „Triple A“ Game werden Spiele von großen Publishern bezeichnet, die meist ein sehr hohes Budget und hohen Ressourceneinsatz nutzen. Sie haben das Potenzial der „Player agency“ (Brazie, 2024) erkannt. Dieser explorative Umgang mit Herausforderungen fördert nicht nur das Problemlösen, sondern auch die mentale Flexibilität und die Fähigkeit, verschiedene Lösungsansätze kritisch zu evaluieren – Fähigkeiten, die in unserer sich schnell verändernden Gesellschaft von unschätzbarem Wert sind.
Wie können Schüler, Kindern und Jugendlichen Charaktere, Handlungsstränge und Umgebungen selbst erschaffen?
Um eigene Interactive Fiction-Geschichten zu erstellen, sollte zunächst der Plot, die Story kurz in einer „Hookline“ beschrieben werden. Hookline ist ein Begriff aus der Musik: die tragende Melodie, ein prägnanter Satz, der durch Originalität Neugier erzeugt. Die narrativen Elemente sollten daraufhin strukturiert werden, die Motivation der Charaktere, die Erzähl- und Handlungsstruktur werden in Variationen erforscht. Plot und Setting, das Thema, die Welt, in der die Geschichte spielt, werden festgelegt. Die Storyline der Interactive Fiction legt fest, welche Pfade die Geschichte nehmen kann und wie der Nutzer mit ihr interagiert.
Ein kohärenter Kontext stärkt die Glaubhaftigkeit der Geschichte und Agenda der Charaktere. Sie müssen „funktionieren“ und stimmig zur Physik, Umgebung und Kultur der Story-Welt erschaffen werden. Darauf basierend erfolgt der Entwurf von narrativen Zweigen, verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, die den Nutzer Entscheidungen treffen lassen und die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Für den Entwurf der Dialoge sind Dialogbausteine sinnvoll: Multiple-Choice-Dialoge oder freie Antworten führen zu unterschiedlichen Reaktionen. Variablen, die den Kontext der Geschichte verfolgen, wie beispielsweise die Freundschaft zu einem Charakter oder die moralische Ausrichtung, unterstützen die Glaubwürdigkeit.
Zur Entwicklung von Textadventures und grafischen Point & Click Adventures entwarf Ron Gilbert, Game Designer erfolgreicher Spiele wie „Monkey Island“ und „Maniac Mansion“, die Methode der „Puzzle Dependencies Charts“ (Gilbert, 2014). Mit Hilfe von Entscheidungsbäumen werden Szenen, Puzzles und der Fortgang der Geschichte konzipiert.
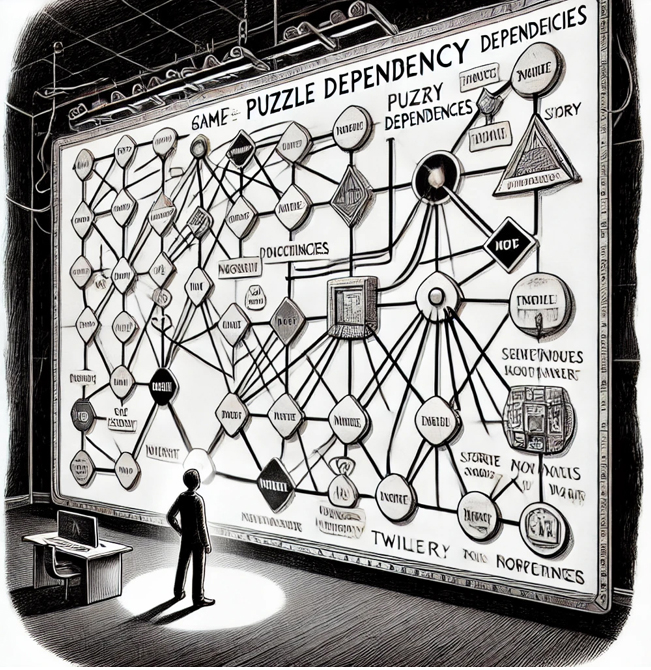
Bild: Trautzsch, 2024 Ein Bild von „Puzzle Depency Charts“ in einer virtuellen Umgebung. Dall-E, 2024
Zeitgenössische Tools helfen jungen Gestaltern, ihre Geschichten zu entwickeln, beispielsweise mit „Twine“. Twine ist eine der beliebtesten Plattformen für die Erstellung von Interactive Fiction. Einfache Verzweigungen können erstellt und mit HTML, CSS und JavaScript angepasst werden.
„Ink“, ein flexibles Scripting-Tool von Inkle (den Machern des „80 Days„-IF Games) ermöglicht die Entwicklung von komplexen Geschichten, die auch in andere Programme, etwa der Game Engine Unity, integriert werden kann. Ren'Py ist ein weiteres Open Source Tool, ideal für Visual Novels, mit Python als Grundlage für komplexere Storyline mit grafischen Umgebungen und Dialogen.
Die Geschichte sollte nun verfeinert geschrieben und getestet werden. Eine gute Vorgehensweise ist, zunächst einen Prototypen in einer der oben genannten Tools zu schreiben und ihn selbst oder mit Freunden zu testen. Hier wird Feedback eingesammelt und die Story, der Ablauf und die Erzählung werden entsprechend angepasst. Viele Tools bieten die Möglichkeit, das Projekt als Webanwendung zu veröffentlichen. Auch Plattformen wie Unity oder Godot können verwendet werden, um die Geschichte, das Projekt als eigenständige Anwendung zu veröffentlichen.
Interactive Fiction erfordert häufig, dass Spieler:innen logische Abfolgen von Handlungen planen und textbasierte Befehle eingeben. Dies fördert grundlegende Programmierfähigkeiten, wie das Verständnis von Syntax und logischen Abhängigkeiten. In vielen IF-Spielen, beispielsweise dem preisgekrönten 80 Days von Inkle Studios (2014), müssen Spieler:innen Informationen analysieren, kombinieren und strategisch nutzen, um Rätsel zu lösen oder die Geschichte voranzutreiben. Dies stärkt digitale Informations- und Wissensmanagementkompetenzen sowie kritisches Denken.
Spiele wie Detroit: Become Human (2018) simulieren komplexe Szenarien, in denen Spieler:innen Entscheidungen treffen müssen, die durch KI beeinflusst werden. Solche Spiele fördern ein kritisches Verständnis für die ethischen und praktischen Herausforderungen von KI-Anwendungen, Problemlösungskompetenzen und Entscheidungsfindungsfähigkeiten.
Förderung von Empathie und Reflexion durch KI und Interactive Fiction
In der Kombination von Künstlicher Intelligenz (KI) und Interactive Fiction entsteht ein innovatives und reichhaltiges Medium, das nicht nur Erzählungen erlebbar macht, sondern auch die Fähigkeit zur Reflexion und Empathie bei den Spielern fördert. KI in IF ermöglicht es, dass Geschichten dynamisch auf die Entscheidungen der Spieler reagieren und sich flexibel an deren Interaktionen anpassen. Dies schafft immersive narrative Welten, in denen Spieler nicht nur Entscheidungen treffen, sondern auch deren moralische und emotionale Konsequenzen reflektieren müssen. Der Literaturwissenschaftler Mark Riedl beschreibt diesen Prozess als „narrative Intelligenz“ der KI, die den Spielern eine komplexe Welt eröffnet, in der sie durch ihre Entscheidungen moralische und ethische Dilemmata erforschen können. „Narrative intelligence is the ability to craft, tell, understand, and respond affectively to stories. Research in computational narrative intelligence seeks to instill narrative intelligence into computers. In doing so, the goal of developing computational narrative intelligence is to make computers better communicators, educators, entertainers, and more capable of relating to us by genuinely understanding our needs. Computational narrative intelligence is as much about human-computer interaction as it is about solving hard artificial intelligence problems” (Riedl, 2017).
„Erzählerische Intelligenz ist die Fähigkeit, Geschichten zu erfinden, zu erzählen, zu verstehen, und emotional auf Geschichten zu reagieren. Die Forschung im Bereich der computergestützten narrativen Intelligenz zielt darauf ab, diese menschliche Form der narrative Intelligenz auf Computerprogramme zu übertragen. Dabei ist das Ziel der Entwicklung von computergestützter narrativer Intelligenz, Computer zu besseren Kommunikatoren, Pädagogen zu machen, die in der Lage sind, mit uns in Beziehung zu treten, indem sie unsere Bedürfnisse wirklich verstehen. Bei computergestützter narrativer Intelligenz geht es ebenso sehr um die Interaktion zwischen Mensch und Computer wie um die Lösung schwieriger Probleme der künstlichen Intelligenz“ (Riedl, 2017).
In Interactive Fiction-Anwendungen übernehmen die Spieler die Rolle von Figuren mit unterschiedlichen Hintergründen und Werten, der oder die Benutzer:in muss sich entscheiden, was der nächste Schritt sein sollte, was gut und sicher oder im Sinne der inneren Logik des Charakters sein soll. Dadurch schafft IF eine tiefere Ebene des reflektierten und empathischen Erlebens und verdeutlicht hier eine vertiefte Auseinandersetzung mit etischen und philosophischen Fragen.
Die multiperspektivische Auseinandersetzung ermöglicht es, aus der eigenen Emotion und Ideologie Einfühlungsvermögen und das Verständnis für komplexe soziale Dynamiken zu stärken. Ein Beispiel könnte die Analyse eines Spiels oder einer Geschichte, in der Spieler Entscheidungen aus einer anderen kulturellen oder sozialen Perspektive treffen, sein.
Darüber hinaus bieten KI-basierte narrative Systeme die Möglichkeit, Perspektivwechsel und Empathie zu fördern, indem sie die Spieler:innen in Rollen versetzen, die kulturell oder sozial von ihrer eigenen abweichen. Dies schafft eine größere Auseinandersetzung und empathisches Erleben der Charaktere und ihren Lebensumständen und fördert das Einfühlungsvermögen auf eine Weise, die in traditionellen, statischen Medien nur schwer erreichbar ist. Psychologische Studien wie die von Jeremy Bailenson zu digitalen Perspektivwechseln, haben gezeigt, dass interaktive und immersive Erzählformate das Empathievermögen stärken können, da sie ein „erlebtes Verständnis“ für verschiedene Lebensperspektiven ermöglichen (Bailenson, 2018).
Spiele, die KI-gestützte Mechaniken integrieren, wie adaptive Schwierigkeitsgrade oder NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere) mit Lernalgorithmen, ermöglichen Spieler:innen, die Funktionsweise von KI praktisch zu erleben und bieten ein großes Experimentierfeld. Plattformen wie „AI Dungeon“ lassen die Handlung mittels KI fast endlos weiterfließen. Die geht auf die Entscheidungen der Spieler ein und generiert dynamisch neue Inhalte. Die Plattform, das Spiel, das auf KI-generierter Interactive Fiction basiert, fördert ein Verständnis dafür, wie maschinelle Sprachverarbeitung funktioniert und welche Einschränkungen dabei existieren. Grundlage sind hier analoge Spiele und Solo-Adventures wie Dungeons & Dragons, die von Spieler:innen selbst entworfen und mittels Würfel, Level Environments und Role-play Game-Spielregeln gespielt werden.
Die Webplattform und Mobile Apps wie „Once Upon a Bot“ kombinieren GPT-3 und Stable Diffusion, um personalisierte, illustrierte Geschichten zu generieren. Allerdings orientieren sich diese nur an einem initialen, erdachten Szenario oder einer Story-Idee, die Kinder eingeben können. Es gibt mittlerweile einige spannende KI-Tools, die bereits Ansätze für interaktive, "lebendige" Illustrationen bieten und in Kinderbuchprojekten verwendet werden können. Storybird ist zwar kein typisches KI-Illustrationstool, aber es ermöglicht Kindern, Geschichten durch Auswahl von vorgefertigten Illustrationen selbst zu gestalten. Es könnte in Zukunft um KI-Technologie erweitert werden, um die Illustrationen dynamisch an den Handlungsverlauf anzupassen. Gamifizierte Lernplattformen wie CodeCombat kombinieren narrative Elemente und KI-gestützte Mechaniken, um Programmierfähigkeiten oder den Umgang mit KI in einem interaktiven, spielerischen Kontext zu vermitteln.
Die Soziologin Sherry Turkle betont, dass digitale Medien, die Handlungsfreiheit und weitreichende Interaktivität erlauben, Reflexion fördern, indem sie den Nutzer:innen/Spieler:innen die Möglichkeit geben, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen und Handlungen unmittelbar zu erleben: „From the start, people used interactive and reactive computers to reflect on the self and think about the difference between machines and people. Were intelligent machines alive? If not, why not? In my studies I found that children were most likely to see this new category of object, the computational object, as "sort of" alive-a story that has continued to evolve“ (Turkle, 2011, S.2).
Narrative Tools, ChatGPT-basierte Storybuilder, ermutigen Spieler:innen, mit KI als Partner in kreativen Prozessen zu arbeiten. Dies schult Fähigkeiten im Bereich der Zusammenarbeit mit intelligenten Systemen. Wenn wir jetzt KI einerseits als innerer Partner oder Denkhilfe und kreatives Werkzeug in den Gestaltungsprozess implementieren, können Geschichten eine glaubhaftere, kohärentere Weltdarstellung unterstützen. So können in einem vernetzen, gut nachvollziehbarem System Dialoge und Charaktere in Co-Creation mit dem Computer erstellt werden.
Eine Möglichkeit, Interactive Fiction direkt als Spiel zu erstellen, sind Chat GPT Custom-Modelle. Mittels LLM und dem integrierten generativ-bildgebenden KI-Modell „Dall-E“ können auf der Grundlage von Textbeschreibungen (Prompts) detaillierte Illustrationen erstellen. In Kombination mit der Erstellung eines Story-Pfades oder auch nur wie im vorliegenden Beispiel, initialen Sätzen können ganze direkt spielbare Anwendungen erzeugt werden. Sie sind flexibel und könnten in einer kinderfreundlichen Variante eingesetzt werden. Durch einen einfachen Texteditor könnten Kinder eingeben, wie ihre Charaktere oder Umgebungen aussehen sollen, und die KI kann daraus sofortige Illustrationen generieren.
Dieses Konzept lässt sich über die API-Einbindung in ein interaktives Tool für Kinderbücher umwandeln und auf externen Plattformen nutzen.
Zunächst sollte das Genre, Setting und Thema gewählt werden. Soll es eine Fantasy-, Sci-Fi-, Horror-, Krimi- oder Abenteuerstory sein? Welche Tonalität soll die Geschichte haben? Soll die Geschichte humorvoll, düster, ernst oder kindgerecht sein? Zuletzt sollte die Art der Interaktionen gewählt werden. Soll der Nutzer Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte verändern, oder soll die Geschichte in eine Richtung gehen und der Nutzer hilft, Details auszufüllen?
Der Story-Entwurf kann jetzt in einen Custom GPT-Modell umgewandelt werden: In Abschnitte aufgeteilt, die zwischen den Entscheidungspunkten liegen, weiß das Modell, wo es Nutzerentscheidungen einfügen soll. In den Text werden nun Platzhalter für Benutzeroptionen eingefügt, damit das Modell weiß, wann es den Nutzer um eine Entscheidung bitten soll. Durch Testen der Geschichte mit Testnutzern wird sichergestellt, dass die Erzählung und die Entscheidungsstruktur gut funktionieren. Auch hier kann der Verlauf der Geschichte verfeinert und angepasst werden an, wenn durch die Tests festgestellt wurde, dass bestimmte Entscheidungen stärkere Auswirkungen oder spannendere Wendungen haben könnten.
Freunde oder Familienmitglieder können nach Feedback befragt werden, insbesondere die Zielgruppe Kinder, falls möglich, um zu sehen, wie sie die Geschichte interpretieren.
„Interactive Fiction“ ist ein Chat GPT Custom Model, das zufällig und frei Geschichten auf Basis initialer Sätze generiert und mögliche Entscheidungen über den Verlauf der Geschichte anbietet, das direkt ausprobiert werden kann. Die Illustrationen werden vom Modell formuliert. Hier müssen Nutzer:innen nach den Textabschnitten nur noch den Prompt, die Anweisung „Bitte erstelle die Illustration zum Text“ eingeben.
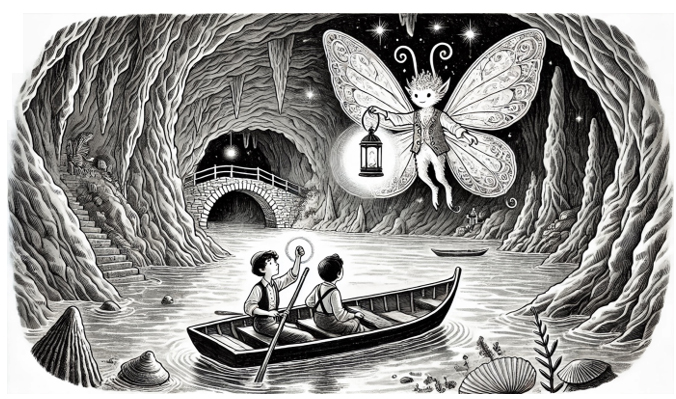
Trautzsch, 2024 Illustration zu einer generativen Geschichte des Custom GPT Models. Dall-E, 2024
Insgesamt eröffnet die Verbindung von KI und IF neue Möglichkeiten, narratives Lernen, Reflexion und Empathie auf spielerische Weise zu fördern (Feige, 2015).
Daniel Martin Feige thematisiert in seinem Werk 'Computerspiele: Eine Ästhetik' (2015) die ästhetische und philosophische Dimension von Computerspielen, einschließlich ihrer narrativen und interaktiven Aspekte, was Rückschlüsse auf Interactive Fiction erlaubt. Feige untersucht Computerspiele als spezifische Kunstform, die sich durch ihre interaktive Struktur und das aktive Eingreifen der Spielenden auszeichnet. Er argumentiert, dass Computerspiele die Fähigkeit besitzen, menschliche Handlungsmöglichkeiten und ethische Entscheidungsprozesse in einer virtuellen Umgebung zu simulieren und zu erforschen (Feige, 2015): „Computerspiele fordern den Spieler nicht nur als rezipierenden, sondern auch als handelnden Akteur heraus, der innerhalb einer künstlichen Welt Entscheidungen treffen muss, die nicht nur spielmechanische, sondern auch narrative und moralische Konsequenzen haben können“ (Feige, 2015, S. 85).
Für Feige sind Computerspiele nicht nur interaktive Medien, sondern Räume der Reflexion, in denen die Spieler durch die narrative Struktur und Interaktivität ihre eigene Handlungsfreiheit und moralischen Werte erforschen können. Diese Perspektive deckt sich mit zentralen Merkmalen der Interactive Fiction, in der die Spielenden Entscheidungen treffen, die die Geschichte beeinflussen, und somit eine aktive Rolle in der narrativen Struktur übernehmen. Feiges Ansatz hebt hervor, dass Interactive Fiction als eine Form der Kunst das Potenzial hat, das menschliche Selbstverständnis und die Vorstellung von moralischer Agency innerhalb einer künstlich erzeugten Welt zu reflektieren und zu erweitern.
IF wird durch das aktive Involvieren des Spielers zu einem Werkzeug der Reflexion und Exploration, das die Wahrnehmung und das Denken herausfordert und die Beziehung zwischen Medien, Zeit und Handlung auf innovative Weise erweitert. Die digitalen Erzählwelten bieten einen Raum, in dem Spieler nicht nur Handlungsmöglichkeiten ausprobieren, sondern auch über ihre Verantwortung und die ethischen Implikationen ihrer Entscheidungen nachdenken können. Die Reflexion über eigene und fremde Perspektiven stärkt nicht nur das Bewusstsein für soziale und kulturelle Unterschiede, sondern auch das Verständnis für die Komplexität menschlicher Entscheidungen und deren Auswirkungen. In seinem Werk Das Bewegungs-Bild unterscheidet Deleuze zwischen verschiedenen Arten von Bildern und untersucht, wie Filme durch das Zusammenspiel von Bewegung und Zeit das Denken beeinflussen (Deleuze, 1996). Das „Bewegtbild“ bei Deleuze beschreibt eine Art von Bild, das nicht statisch ist, sondern durch Zeit und Dynamik das Bewusstsein des Betrachters aktiv beeinflusst. Interactive Fiction schafft narrative Bilder und Szenarien, die sich je nach Interaktion des Spielers verändern. Dieser Prozess verlagert die Rezeption von passivem Konsumieren zu einer aktiven, dynamischen Gestaltung der Geschichte – die Spieler werden nicht nur zu Rezipienten, sondern zu Mitautoren des Geschehens. So wie Deleuze das Bewegtbild als eine Erweiterung des Wahrnehmungsspektrums ansieht, erweitert IF durch interaktive Entscheidungen das narrative Spektrum und die Tiefe der Interpretation. Es verhilft zu einer Multiperspektivität die Schlüssel- und Zukunftskompetenz.
Heute und zukünftig stellen Zukunfts- und KI-Kompetenz eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen für das Berufsleben und die Grundlage für die Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels, der Transformation der Arbeitswelt durch fortschreitende Technologie, dar. Interactive Fiction bietet eine Plattform, die es jungen Nutzer:innen ermöglicht, zu kreativen Gestaltern und reflektierten Nutzern digitaler Medien zu werden. Mittels Spielelementen, wie Herausforderung, individuellem zeitlichen Fortschritt und Entscheidungsmöglichkeiten unterstützt es die intrinsische Motivation junger Menschen. Durch dieses „erlebnisbasierte“, situative Lernen, die aktive Teilnahme an Geschichten und die Steuerung von Handlungsverläufen erlernen junge Spieler:innen Entscheidungen und deren Konsequenzen zu durchdenken und zu reflektieren. Die Interaktion mit KI-gestützten Geschichten hilft jungen Menschen, ein kritisches Bewusstsein für digitale Medien zu entwickeln und sich ihrer eigenen Rolle in der digitalen Welt bewusst zu werden. Es entsteht ein kreativer Freiraum, ein Potenzial für die Entwicklung einer bewussten und reflektierten Medien- und KI Kompetenz.
Interaktive Medien und Anwendungen mit Spiel- und Interactive Fiction-Elementen können als didaktisches Mittel, das nicht nur unterhält, sondern auch zur Entfaltung kreativer Potenziale beiträgt, eingesetzt werden.
Digitale Inhalte sind zunehmend automatisiert und werden durch Algorithmen gesteuert, sie erlauben den Rezipient:innen mehr als nur Konsument und Zuschauer zu sein. Augmented KI-Systeme aus dem Silikon Valley streben nicht die Unterstützung des Menschen an, sondern versuchen ihn aus ökonomischen Beweggründen obsolet zu machen. Hier bietet Interactive Fiction eine Balance zwischen menschlicher Kreativität und technologischer Unterstützung. Sie verbindet das Beste aus beiden Welten und zeigt, wie digitale Medien so gestaltet werden können, dass sie die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung nachhaltig bereichern.
Interactive Fiction ist somit mehr als nur ein unterhaltsames , narratives, spielerisches Medium, es kann ein mächtiges Werkzeug zur Förderung kreativer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten sein, das Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen wertvolle Kompetenzen vermittelt. Durch Interactive Fiction werden Spieler zu aktiven Gestaltern ihrer eigenen narrativen Welten, wodurch sie nicht nur ihre Kreativität, sondern auch ihre Problemlösungsfähigkeit und Empathie entwickeln. Die Nutzung von KI in Interactive Fiction-Formaten intensiviert diese Erfahrung, indem sie dynamische Erzählwelten ermöglicht, die flexibel auf die Entscheidungen der Spieler reagieren und sie so zu einer bewussten Reflexion über die Konsequenzen ihres Handelns anregen.
Für Kinder und Jugendliche im digitalen Zeitalter eröffnet IF einen Weg, sie dort abzuholen, wo sie sich aufhalten: in virtuellen Spielwelten und digitalen Medienplattformen. Sie können lernen, Medien nicht nur zu konsumieren, sondern selbstbestimmt zu nutzen und kritisch zu hinterfragen. Sie lernen, dass Mediengestaltung Verantwortung bedeutet und dass ihre Entscheidungen, ob virtuell oder real, Auswirkungen haben. Die Erfahrungen, die sie durch IF sammeln, bereiten sie auf eine Zukunft vor, in der kreative und reflexive Fähigkeiten zu den Schlüsselkompetenzen gehören (Future Skills, 2025). Interactive Fiction kann als kreatives Werkzeug eingesetzt werden, das junge Menschen zu bewussten Gestaltern und Problemlösern in einer komplexen, digitalen Welt macht. Narrative Perspektivwechsel und das aktive Erleben moralischer Dilemmata bieten jungen Menschen die Möglichkeit, sich in unterschiedliche Charaktere hineinzuversetzen und ethische Fragestellungen zu reflektieren. Diese Erfahrungen fördern das Einfühlungsvermögen und das kulturelle Verständnis, wichtige Kompetenzen in einer vielfältigen Gesellschaft.
Diese Fragestellungen, die Betrachtung und Beantwortung ethischer Leitfragen und die Fähigkeit zur Multiperspektivität sind essenzielle Kompetenzen, die wir als Menschen in der Informationsrevolution und der KI-Transformation dringend benötigen McGonigals (2011). Vision, Spiele als Werkzeuge zur Verbesserung von Individuen und Gesellschaft zu nutzen, zeigt sich in der Fähigkeit von Spielen, sowohl technische als auch soziale Fähigkeiten durch Experimente, Narration und Zusammenarbeit zu fördern. Interactive Fiction bietet immersive, interaktive Umgebungen, die es ermöglichen, digitale und KI-Kompetenzen in einem sicheren und motivierenden Umfeld zu erlernen.
Interactive Fiction didaktisch im Bildungsbereich einzusetzen kann somit junge Menschen auf eine Zukunft vorbereiten, in der sie nicht nur technologisch versiert, sondern auch zu reflektierten und empathischen Mitgliedern der digitalen Gesellschaft entwickeln. Durch die Kombination von kreativer Gestaltung, interaktivem Problemlösen und empathischer Reflexion stellt IF eine umfassende Bildungsressource dar, die Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung nachhaltig unterstützt.![]()
Literaturverzeichnis


Nadine Trautzsch
Prof. Nadine Trautzsch ist Dipl.-Designerin, Illustratorin und Game Designerin. Zusammengefasst: System und Experience Designerin für digitale und analoge Medien. Sie ist Professorin an der IU Internationalen Hochschule und lehrt im Fachgebiet Design & Architektur im Studiengang Game Design und Game Art.
Website