



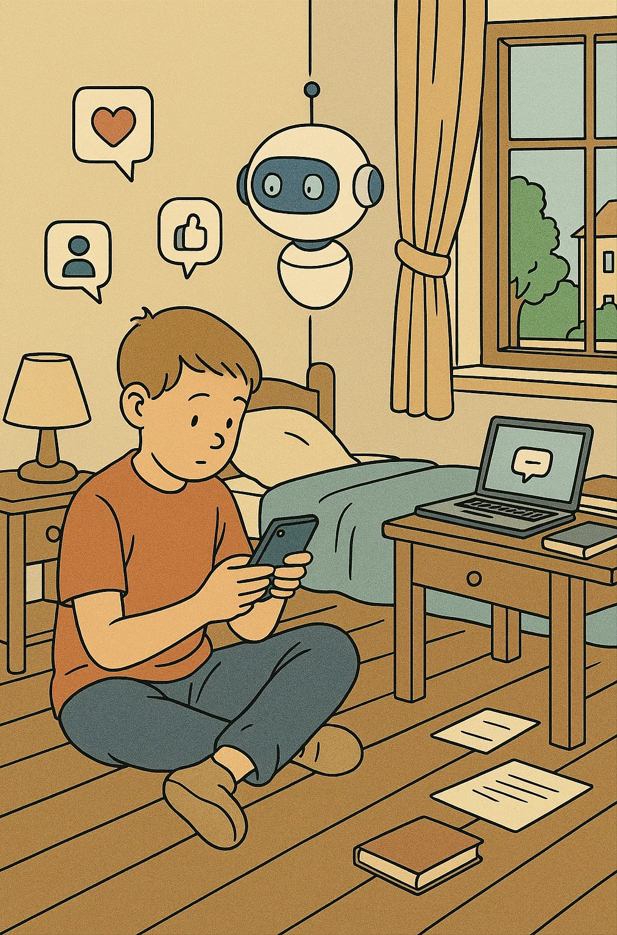

Text: Tom Braun und Jule Korte
Bild: Sora (Prompt: Björn Brückerhoff)


Postdigitale Erfahrungswelten?
Im Übergang von den technischen Transformationen der Digitalisierung zu den gesellschaftlich-kulturellen Prozessen der Postdigitalität (Cramer 2014) hat sich nicht nur die Art und Weise verändert, wie wir kommunizieren und arbeiten, sondern auch, wie wir unsere Identität bilden, soziale Gemeinschaften formen, wie wir uns und andere wahrnehmen und erfahren. Wir erleben einen umfassenden kulturellen Transformationsprozess, bei dem digitale Technologien tief in soziale, kulturelle und politische Umwelten eingebettet sind. Damit haben digitale Medien heute weitaus mehr Bedeutung, als dass sie einfach nur Geräte, also Hard- oder Software, oder bestimmte Funktionen bezeichnen: Sie sind, so schreibt es Kristin Klein 2019, inzwischen „soweit mit sozialen, kulturellen und politischen Umwelten verwoben, dass sie dort neue symbolische Formen, Erkenntnismuster und Praktiken strukturieren, die wiederum für die postdigitale Realität, in der wir leben, konstitutiv sind“ (Klein 2019).
Für Kinder und vor allem Jugendliche ist das Leben mit digitalen Medien längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Schon allein technologisch betrachtet ist die reine Verfügbarkeit von Technologien wie Smartphones und Laptops und dem entsprechenden Internetzugang in den Haushalten, in denen Jugendliche leben, bereits im Jahr 2020 nahezu flächendeckend gegeben (vgl. Rohde 2022, S. 452). Die Nutzung entwickelt sich vom Streamen und Spielen hin zu sehr ausdifferenzierten kommunikativen und kreativen Funktionen (mpfs 2020; Rohde 2022). Jugendliche erleben die postdigitale Transformation insofern also weniger explizit als eine Zustandsveränderung, vielmehr scheint es, dass ihre Wahrnehmungs- und damit auch Selbstwahrnehmungsmuster ganz grundlegend postdigital strukturiert sind: „On- und Offline-Leben […] [ist] für Jugendliche nicht mehr voneinander zu trennen“ (BMFSFJ 2017, S. 276).
Postdigitalität lässt sich in dieser Hinsicht hier als eine Art von Erfahrungsökologie (Korte 2020) beschreiben, in der die Grenzen von Kategorien wie online und offline, analog und digital, virtuell und real, medial und außermedial bis hin zur Untrennbarkeit verwischen. Mit dem Begriff der Erfahrungsökologie geht es im Kern darum, mediale und außermediale Erfahrungen nicht als Erfahrungen zweier getrennt voneinander gefasster Bereiche zu verstehen. Insbesondere auf der Ebene der affektiven Involviertheit lassen sich bspw. die Bedeutungen, die mediale Inhalte für ihre Rezipient:innen entfalten, nicht von solchen trennen, die durch außermediale Erfahrungen ermöglicht werden. Damit verbunden ist ebenfalls der Anspruch, einer Trennung von Subjekt und Objekt individueller Erfahrung einen Begriff entgegenzusetzen, der von einer grundsätzlichen, vorgelagerten Relationalität ausgeht, also der Idee, dass bspw. Mediennutzer:innen und mediale Inhalte nicht als sich einander gegenüberstehende Akteur:innen aufeinandertreffen, sondern als solche aus einer gemeinsamen Erfahrungsökologie überhaupt erst hervorgehen. Insbesondere Bedeutungen oder Bedeutsamkeiten generieren sich so verstanden nicht mehr aus der einen oder der anderen „Erfahrungswelt“, sondern bringen relational neue, spezifische Bedeutungen und damit wiederum andere, gemeinsame Erfahrungen hervor. Dieses Konzept ist überaus anschlussfähig an postdigitale Lebenswelten, denn: Für die Jugendlichen, von denen hier die Rede ist, gibt es „kein Leben ‚vor den Medien‘ […]. Fernsehen, Smartphone, Internet – mit all den Formaten, die jeweils dazu gehören, sind seit jeher fester Bestandteil ihrer alltäglichen Erfahrung. Sie haben über diese Medien insofern vielleicht auch weniger ‚gelernt‘, als dass sie sie erfahren haben: als Dynamiken einer gemeinsamen Erfahrungsökologie, deren Teil sie immer bereits waren und sind“ (Korte 2020, S. 242).
Diese Entwicklung zieht Konsequenzen nach sich, die unter anderem auch die Konzeption und Ausrichtung bestimmter kultur- und medienpädagogischer Angebote betreffen, denn: Die erwachsenen Fachkräfte, die diese Angebote konzipieren, haben unter Umständen eine ganz andere gemeinsame Erfahrungsgeschichte mit – und damit einhergehend auch eine andere Haltung zu – digitalen Medienphänomenen als die Jugendlichen, für die sie ihre Angebote konzipieren. Im Rahmen eines Praxisforschungsprojekt an der IU Internationale Hochschule wird deshalb untersucht, mit welchen Haltungen Fachkräfte der Jugendkulturarbeit digitalen Medienphänomenen begegnen. Dabei geht es in dem durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI) geförderten Projekt unter anderem um die Frage, welchen Konventionen sich Erwachsene in professionell organisierten non-formalen Bildungsangeboten verpflichtet sehen, und mit welchen Verhaltenserwartungen sie Jugendlichen im Umgang mit digitalen Medienphänomenen begegnen.
Distanz und Reflexion vs. Immersion?
Etablierte kultur- und medienpädagogische Leitbegriffe und Konzepte zielen darauf ab, die bestmögliche autonome Eigenständigkeit von Individuen zu fördern (vgl. Kooy 2022, 70; Tillmann 2018). Konzepte der Medienpädagogik, bspw. etablierte Begriffe von Medienkompetenz, beinhalten derart immer auch das Ziel, gegenüber Medien vor allem das kritisch-distanzierte Urteilsvermögen und die kognitive Reflexionsfähigkeit der Jugendlichen zu fördern. Vereinfacht gesagt geht es dabei (unter anderem) darum, Jugendliche zu einem Verständnis davon zu befähigen, was Medien ‚mit ihnen machen‘, um diesen technologischen Mechanismen nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Gleichermaßen sollen Jugendliche also rational informiert mit Medien umgehen können und auf eine bestimmte Art und Weise befähigt werden, etwas ‚mit den Medien zu machen‘. Neuere Forschungen zeigen aber auch, dass Nutzungserfahrungen Jugendlicher Konventionen eines instrumentellen Medienverständnisses überschreiten. So betont z. B. Angela Tillmann besondere medienkulturelle „Autonomie-, Identitäts- und Vergemeinschaftungserfahrungen“ (Tillmann 2018, S. 135) sowie die Bedeutung medialer Praktiken zur Beziehungspflege (Schmidt/Paus-Hasebrink/Hasebrink 2009: 201ff., zit. in Tillmann 2018, S. 136). Auch werden neue mediale Praktiken der Selbstinszenierung als Formen performativer Identitätskonstruktion, die besonders Aspekte der Erprobbarkeit von Identitätsentwürfen einbeziehen, beschrieben (Kooy 2022, S. 70; Tillmann 2008). Weiterhin werden digitale Medien als Orte reflektiert, die Zugehörigkeitserfahrungen zu jugendkulturellen Communities durch bestimmte Handlungs- und Artikulationsweisen ermöglichen (vgl. Krotz/Schulz, 2014). Dies ist besonders interessant mit Blick auf ästhetisch-kulturelle Praktiken, welche die Gestaltbarkeit von Erfahrungswelten als bedeutsames Moment hervorheben: Forschungen zu digitalen Medien und kulturell-ästhetischen Praktiken zeigen sehr deutlich, dass sich die Bedeutung, die digitale Medien im Alltag bzw. im lebensweltlichen Kontext für Jugendliche besitzen, weder auf ihre informationstechnisch kommunikativen Funktionen noch auf die Befriedigung jugendlicher Bedürfnisse beschränken. So konnten neueste Untersuchungen zeigen, dass digitale Medien bspw. ganz maßgeblich an der Konstitution jugendkultureller, auch kreativ künstlerischer Praktiken beteiligt sind. Beispielsweise geben 75% der im Rahmen einer Studie von Werner Thole, Ivo Züchner, Julia Rohde und Viktoria Pfeifer befragten Jugendlichen an, dass sie digitale Medien, bspw. ihr Smartphone, in ihrer Freizeit zu kreativ-künstlerischen Zwecken nutzen (vgl. Rohde 2022). Eine Studie zu „postdigitalen kulturellen Jugendwelten“ kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Susanne Keuchel und Steffen Riske (2020) beschreiben sogar eine Zunahme künstlerisch-kreativer Aktivitäten bei Jugendlichen durch analog-digitale Formate, und beobachten insbesondere neue Ausdrucksformen, die durch die postdigitale Nutzung digitaler Medien entstanden sind. Medien haben derart auch „ästhetische und künstlerische Praktiken erheblich transformiert“ (Jörissen/Schröder/Carnap 2020, S. 62). Analog und digital verschwimmen als Kategorien hier also auch auf der Ebene kreativer Ausdrucksformen. Die Konsequenzen, die bspw. Jörissen et al. (2020) daraus ziehen, sind folgenreich und überaus relevant, wenn es um die Entwicklung jugendkultureller Angebote geht, und insb. auch um die impliziten Voraussetzungen dafür – also die Leitbegriffe, Motive, Bildungs- und Handlungsziele, die mit solchen Angeboten verfolgt werden. Jörissen et al. machen nämlich darauf aufmerksam, dass es vor dem Hintergrund postdigitaler kultureller Jugendwelten im Grunde genommen eine Verschiebung der Bedeutung des Kreativitätsbegriffes gibt, und zwar von einer subjektorientierten, individuellen Kreativität zu einer hybriden und vernetzten kreativen Praxis (vgl. Jörissen et al. 2020). An dieser postdigitalen Praxis sind demzufolge nicht mehr nur menschliche Akteur:innen beteiligt, vielmehr finden kreative Praktiken in diesem Sinne – innerhalb einer gemeinsamen Erfahrungsökologie – in Kooperation mit algorithmisierter Software, Hardware und Netzwerken statt. Das bedeutet: Jugendliche werden gemeinsam mit algorithmisch vorstrukturierten Elementen kreativ, die Art, bspw. algorithmische Strukturen zu durchschauen, liegt darin, mit ihnen zusammenzuarbeiten, wie Viktoria Flasche (2022) in einem ähnlichen Zusammenhang betont. Ihr zufolge wird die Erfahrung der eigenen Kreativität für Jugendliche nur dann möglich, wenn sie sich „auf eine bestimmte Art affirmativ“ (Flasche 2022, S. 50) auf die Struktur des Algorithmus bzw. die Netzwerklogik einlassen. Das bedeutet also weiterhin, dass eine selbstbestimmte Nutzung digitaler Medien hier ggf. eher eine unmittelbare emotionale Verbundenheit mit den medientechnologisch induzierten Praktiken voraussetzt, statt auf einer kritischen Distanznahme zu beruhen. Postdigitale Denk- und Handlungsweisen von Jugendlichen scheinen also derzeit eher durch immersive Involvierung und mediale Nähe gekennzeichnet zu sein, statt durch die Grenzziehung zwischen sich selbst und dem Medium (vgl. hierzu auch Schober et al. 2022). Das bisherige Verständnis von u. a. Medienkompetenz als Fähigkeit zur kritisch distanzierten Mediennutzung und zur reflektierten Mediengestaltung gerät derart ins Wanken.
Für Fachkräfte der Jugendkulturarbeit bedeutet dies, dass bisherige Leitbegriffe ihrer Arbeit, die sich bspw. am traditionellen Medienkompetenzbegriff orientieren und auf Souveränität und autonome Eigenständigkeit des Individuums reflektieren, zunehmend an Passung zu den digitalen „Algorithmuskulturen“ ihrer Adressat:innen verlieren könnten (vgl. Jörissen et al. 2020, S. 74; vgl. zu pädagogischen Deutungsmustern angesichts einer schwindenden Beherrschbarkeit digitaler Medienphänomene auch Leineweber et al. 2023, S. 245).
Fachkräfte als Gatekeeper
Eine wichtige Schlüsselfunktion liegt in den spontanen Deutungsmustern der Fachkräfte (vgl. Rohde 2022; Tillmann 2018). Denn Voraussetzung für eine gelingende Jugendkulturarbeit ist, dass Fachkräfte neben expliziten, reflektorisch zugänglichen Leitbegriffen ihrer Arbeit auch ihre eigenen unbewussten Vorannahmen und Deutungsmuster, insbesondere gegenüber neuen digitalen Technologien, erkennen und reflektieren können. Umso bedenklicher ist es, dass zwar die Gate-Keeper-Funktion spontaner Deutungsmuster, mit denen Fachkräfte auf digitale Medienphänomene reagieren, betont wird (Züchner et al. 2022 nach Rohde 2022), bisher jedoch unklar bleibt, wie genau sich diese Deutungsmuster gestalten. Während es bereits umfangreiche Forschungen zu den medienkulturellen Praktiken Jugendlicher gibt (s. o.), ist wenig über die Einstellungen und Vorannahmen der Fachkräfte bekannt. Diese Forschungslücke will das Projekt schließen. Ziel ist es, die expliziten und impliziten Deutungsmuster der Fachkräfte zu erfassen und ihre Auswirkungen auf die Jugendkulturarbeit zu analysieren. Um auch zukünftig eine anschlussfähige Jugendkulturarbeit gewährleisten zu können, muss geklärt werden, welche Vorannahmen und krisenhaften Beharrungsmomente gegenüber digitalen Medienphänomenen bei Fachkräften bestehen (vgl. Rohde 2022; Tillmann 2018). Das Praxisforschungsprojekt zielt darauf ab, entsprechende Reflexionsprozesse zu unterstützen und derart die Grundlagen für eine aktualisierte professionelle Selbstreflexion zu schaffen.
Kulturpädagogische Leitbegriffe in der postdigitalen Transformation?
Ein empirisches Projekt mit Fachkräften
Das methodische Design des Projekts folgt einem Mixed Methods-Ansatz, also einer Kombination aus quantitativen und qualitativen empirischen Erhebungen, und ist in drei Phasen unterteilt. Um den Zugang zu den Fachkräften zu sichern und die Forschung an der Schnittstelle zur Praxis zu begleiten, wird eng mit den im Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE) sowie in der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e.V. (LKD) organisierten Fachstrukturen zusammengearbeitet. In der ersten, jüngst abgeschlossenen Phase (März 2025) wurde eine Fragebogenstudie durchgeführt, um die zentralen Leitbegriffe der Fachkräfte zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Studie dienen nun als Grundlage für die zweite Phase, in der mehrere Gruppenwerkstätten mit insgesamt etwa 24 Fachkräften aus NRW durchgeführt werden. Diese Werkstätten basieren auf der Methode der Habitus-Hermeneutik (Bremer 2004, Bremer/Teiwes-Kügler 2013), bei der narrative und nicht-narrative Verfahren kombiniert werden, um auch unbewusste Einstellungen, Handlungs- und Denkmuster zu erfassen und auf eine besprechbare Ebene zu bringen. In der dritten Phase werden die Ergebnisse beider Forschungsphasen ausgewertet und miteinander in Beziehung gesetzt. Dabei werden praxisrelevante Handlungsbedarfe identifiziert und Empfehlungen für die Konzeption von Fortbildungsangeboten und Arbeitsmaterialien abgeleitet. Ziel ist es, die fachlichen Grundlagen für eine aktualisierte professionelle Selbstreflexion der Fachkräfte zu schaffen und die medienkulturellen Analysefähigkeiten sowie die Anschlussfähigkeit an postdigitale Lebenswelten Jugendlicher zu fördern. Das Forschungsprojekt soll einen wichtigen Beitrag zur Reformulierung kulturpädagogischer Leitbegriffe in der postdigitalen Transformation leisten.
Projekthomepage
Quellen
Bremer, H. (2004): Von der Gruppendiskussion zur Gruppenwerkstatt: ein Beitrag zur Methodenentwicklung in der typenbildenden Mentalitäts-, Habitus- und Milieuanalyse. Münster: LIT Verlag.
BMFSFJ (2017): 15. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Drucksache 18/11050. Berlin: BMFSFJ
Bremer, H./Teiwes-Kügler, Ch. (2013): Zur Theorie und Praxis der ‚Habitus-Hermeneutik‘. In: Brake et al. (Hg.): Empirisch arbeiten mit Bourdieu. Theoretische und methodische Überlegungen, Konzeptionen und Erfahrungen. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 93-129.
Cramer, F. (2014): What is ‘post-digital’? In: APRJA Volume 3, Issue 1, S. 11-22, URL: https://aprja.net//issue/view/8400/893
Flasche, V. (2022): Jugendliche Selbstentwürfe an der Social-Media-Schnittstelle Ästhetische Artikulationen Jugendlicher auf und mit Social-Media-Plattformen zwischen 2012 und 2018. https://open.fau.de/server/api/core/bitstreams/dcebf120-65b7-43c3-8247-132b3daed563/content
Jörissen, B., Schröder, M. K., & Carnap, A. (2020). Post-digitale Jugendkultur. Kernergebnisse einer qualitativen Studie zu Transformationen ästhetischer und künstlerischer Praktiken. In S. Timm, J. J. Costa & C. Kühn (Hrsg.), Kulturelle Bildung. Münster: Waxmann, S. 61–77.
Keuchel, S./ Riske, S. (2020): Postdigitale kulturelle Jugendwelten. Zentrale Ergebnisse der quantitativen Erhebung. In: Timm, S./Costa, J./Kühn, C./Scheunpflug, A. (2020): Kulturelle Bildung. Theoretische Perspektiven, methodologische Herausforderungen, empirische Befunde. Münster, New York: Waxmann, S. 79-96.
Klein, K. (2019): Ästhetische Dimensionen digital vernetzter Kunst: Forschungsperspektiven im Anschluss an den Begriff der Postdigitalität. In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE, URL: https://www.kubi-online.de/artikel/aesthetische-dimensionen-digital-vernetzter-kunst-forschungsperspektiven-anschluss-den-0
Kooy, H. (2022): Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kontext der Mediatisierung. In: merz | medien+erziehung Ausgabe 04/2022. München: kopaed, S. 69 – 77.
Korte, J. (2020): Zwischen Script und Reality? Erfahrungsökologien des Fernsehens. Bielefeld: Transcript.
Krotz, F. und Schulz, I. (2014): Jugendkulturen im Zeitalter der Mediatisierung. In: Hugger, K. (Hrsg.), Digitale Jugendkulturen. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 31 – 44.
Leineweber, C./Waldmann, M./Wunder, M. (2023): Materialität – Digitalisierung – Bildung: neomaterialistische Perspektiven. In: Derss. (Hg.): Materialität – Digitalisierung – Bildung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, S. 210–257.
MPFS – Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2020): JIM-Studie 2019. Jugend, Information, Medien. Stuttgart: LFK. URL: https://mpfs.de/studie/jim-studie-2019/
Tillmann, A. (2018). Erziehungshilfen im Kontext der Digitalisierung: Herausforderungen und Aufgaben. Forum Erziehungshilfen, 03, 135–140.
Tillmann, A. (2008): Identitätsspielraum Internet. Selbstbildungspraktiken von Mädchen und jungen Frauen in der virtuellen Welt. Weinheim und München.
Rohde, J. (2022): Kulturelle Jugendbildung und Digitalität. Sozial Extra 46, 452–457.
Schmidt, J.-H./ Paus-Hasebrink, I./ Hasebrink, U. (Hrsg.) (2009): Heranwachsen mit dem Social Web. Zur Rolle von Web 2.0-Angeboten im Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Band 62. Berlin.
Schober, M./Lauber, A./Bruch, L./Herrmann, S./Brüggen, N. (2022): ‚Was ich like, kommt zu mir‘ Kompetenzen von Jugendlichen im Umgang mit algorithmischen Empfehlungssystemen. = Qualitative Studie des JFF – Institut für Medienpädagogik im Rahmen von Digitales Deutschland. München, Kopaed. Online abrufbar unter URL: https://digid.jff.de/digid_paper/was-ich-like-kommt-zu-mir-kompetenzen-von-jugendlichen-im-umgang-mit-algorithmischen-empfehlungssystemen/
Züchner, I./Rohde, J./Thole, W. (Hrsg.) (In Vorbereitung) Digitalität in der kulturellen Bildung. Handlungsräume, Handlungsfelder und Angebote aus Perspektiven von Jugendlichen und Anbietern der kulturellen Jugendarbeit.![]()

Tom Braun
Prof. Dr. Tom Braun ist Professor für Kultur- und Medienpädagogik an der IU Internationale Hochschule und Mitglied der wissenschaftlichen Leitung des IU Research Center Kulturelle Bildung – Kulturen postdigitaler Subjektivität. Zuvor war er Geschäftsführer der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) und verantwortlich für die Konzeption und Durchführung bundesweiter Modell- und Praxisforschungsprojekte sowie Maßnahmen zur bundesweiten Feldentwicklung der kultur- und medienpädagogischen Fachstrukturen. Seine Arbeits- und Forschungsgebiete: Theorie und Praxis der Kulturellen Bildung, Kritische Kulturpädagogik, Kulturen postdigitaler Subjektivität, kulturelle Schulentwicklung sowie kinder- und jugendgerechte Ganztagsbildung. Tom Braun ist Mitglied des Beirats der Wissensplattform kubi-online.de.

Jule Korte
Prof. Dr. Jule Korte ist seit 2020 Professorin für Kultur- und Medienpädagogik an der IU Internationale Hochschule und leitet den gleichnamigen Bachelorstudiengang. Sie studierte Kulturwissenschaften und Medienkulturanalyse in Frankfurt (Oder) und Düsseldorf. 2017 promovierte sie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit einer Arbeit zu Scripted Reality-Formaten, Fernseherfahrung und der Frage nach den Methoden ihrer Erforschung. Nach ihrer Promotion arbeitete sie als Postdoc am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Kunstakademie Düsseldorf, wo sie unter anderem die letzte Phase des BMBF-Forschungsprojektes „Transkulturelle Praktiken im postmigrantischen Theater und in der Schule“ koordinierend begleitet hat. Ihr besonderes Interesse gilt den Verflechtungen zwischen medialen Phänomenen und Alltagserfahrung sowie der Frage nach geeigneten empirischen Methoden, die solche Zusammenhänge beschreibbar machen können. Sie ist Mitglied im wissenschaftlichen Leitungsteam des IU Research Center Kulturelle Bildung – Kulturen postdigitaler Subjektivität und im Koordinierungskreis des Netzwerks Forschung kulturelle Bildung. Seit September 2024 leitet sie gemeinsam mit Tom Braun das Forschungsprojekt „Kulturpädagogische Leitbegriffe in der postdigitalen Transformation? Eine empirische Untersuchung mit Fachkräften“ (gefördert durch das MKJFGFI NRW).