



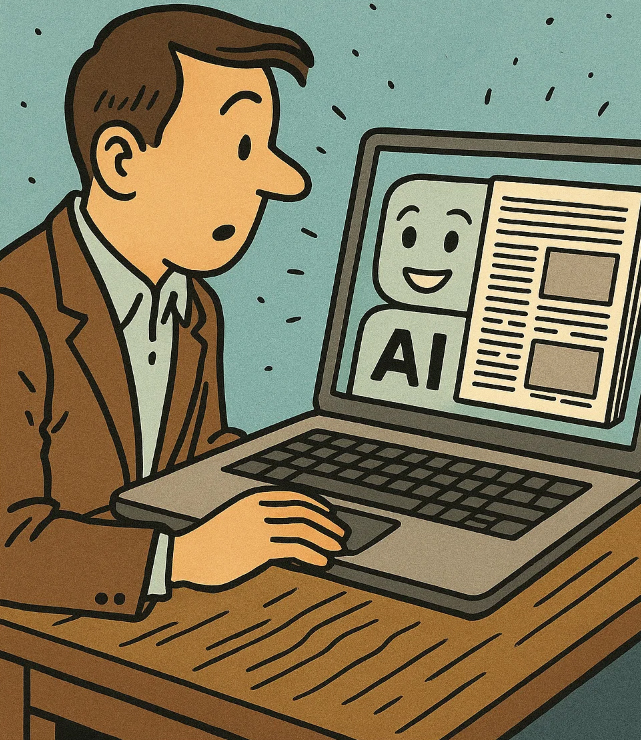

Text: Björn Brückerhoff
Bild: Sora (Prompt: Björn Brückerhoff)

In die Schlagzeilen geraten ist die Washington Post zuletzt, als Amazon-Gründer Jeff Bezos, dem die Zeitung seit 2013 gehört, kurz nach Trumps Amtsübernahme überraschend seine Vorstellungen von den zukünftigen Inhalten der Meinungsseite verkündet hatte. Die individuelle Freiheit und freie Märkte sollten in der Zeitung mehr Aufmerksamkeit erhalten.
Die Vorstellungen des Eigentümers wurden intern durchaus als bindend aufgefasst. Einige Mitarbeitende verließen das Unternehmen. Bezos hatte damit der Glaubwürdigkeit des Blattes, dessen Leitspruch durchaus theatralisch, aber zutreffend "Democracy dies in Darkness" lautet, auch aus Sicht vieler Leserinnen und Leser erst einmal das Licht ausgeknipst.
Fast untergegangen ist in all der Aufregung eine Innovation, auf die auch deutsche Verlagshäuser einen Blick werfen sollten. Mit Ask The Post AI bietet die Zeitung einen KI-gestützten Zugang zu ihrem Artikelarchiv seit 2016. Die Nutzenden fragen, die KI antwortet. Die Datengrundlage der generierten Antworten besteht dabei ausschließlich aus redaktionell geprüften, journalistischen Inhalten.
Das Zeitungsarchiv, das die KI als Grundlage für Antworten nutzt, umfasst lediglich Einträge ab 2016. Das ist für eine Zeitung mit einer Geschichte seit 1877 ein ziemlich kurzer Zeitraum. Mithilfe algorithmischer Bewertungssysteme entscheidet Ask the Post AI über die Relevanz der ausgewählten Artikel für die Beantwortung der Frage. Wenn keine Artikel vorliegen, wird auch keine Antwort gegeben. Das soll die sogenannten Halluzinationen vermeiden, unter denen viele aktuelle KI-Systeme (und damit indirekt auch ihre Nutzerinnen und Nutzer) noch leiden: Die Maschine denkt sich bei fehlenden Inhalten einfach selbst welche aus, die plausibel genug klingen, um zur Frage passen zu können. Das ist generell ein Problem, im journalistischen Kontext aber eine Katastrophe für die Glaubwürdigkeit.
Ein System wie Ask the Post AI hat viele Vorteile für den Erwerb von Medienkompetenz. Für Kinder und Jugendliche beispielsweise, die für die klassische Zeitung oder gar journalistische Inhalte im Allgemeinen oft bereits als verloren gelten, stellt eine Fragen beantwortende KI einen niederschwelligen Zugang zu geprüften Inhalten dar. Sie können sich verlässlich informieren und greifen vielleicht weniger auf Quellen zurück, die sie aus Social Media-Angeboten kennen. Nach positiven Erfahrungen erhöht sich zudem potenziell die Kompetenz bei der Bewertung von Quellen. Auch die Formulierung von Folgefragen wäre ein Erfolg, eventuell sogar motiviert durch Vorschläge der KI. Ob mit der KI auch Nutzerinnen und Nutzern gewonnen werden können, die überhaupt keine journalistischen Inhalte mehr nutzen, ist natürlich noch nicht klar. Hier geht es nicht mehr um die Art der Nutzung, sondern ob diese Personenkreise überhaupt auf die Idee kommen, ein derartiges Angebot zu nutzen.
Ein gutes KI-Tool passt die Komplexität der ausgegebenen Antworten dem Niveau der Fragenden an, sofern das ermittelt werden kann. Auch das Herunterbrechen komplexer Sachverhalte ohne Trivialisierung wäre für bestimmte Zielgruppen ohne Zweifel ein Mehrwert. Kritiker sehen die Gefahr einer gewissen Trägheit der Fragenden: Das eigenständige Erschließen der Inhalte wird enorm erleichtert, die Hürde der aktiven Auseinandersetzung mit den Medieninhalten abgeflacht. Das allerdings ist ein (medien-)historisch immer wiederkehrendes Argument, mit dem zuletzt auch Suchmaschinennutzende zu tun hatten. Auch sonst kommen wieder viele Argumente zum Tragen, die bereits für Suchmaschinen galten, etwa die intransparenten Auswahlkriterien der KI. Hier hilft nur, den Auswahlprozess für die Nutzerinnen und Nutzer so nachvollziehbar wie möglich zu gestalten und damit die Chance zu bieten, zunächst nicht berücksichtigte Artikel auf Anfrage dann doch anzeigen zu lassen.
Kritisch für die Vermittlung von Medienkompetenz ist auch der Umgang mit Fehlern: Es dürfte für die Nutzenden schwierig bis unmöglich sein, falsche oder unvollständige Antworten zu erkennen, wenn die eigenen Kenntnisse dafür nicht ausreichen. Hinweise darauf, dass die dargestellten Informationen nur einen Anfang markieren und durch weitere Recherche mehr Erkenntnisse zu erwarten sind, könnten hier helfen. So entsteht zwar Unsicherheit, aber auch der Umgang mit ihr wird geschult. Das ist eine wesentliche Fähigkeit, die in Zeiten von Fake News, Verschwörungstheorien und fotorealistischer KI-Bilder unverzichtbar ist.
Klar ist jedoch: Wenn die Quellen, auf die sich die KI bezieht, selbst nicht mehr ausgewogen oder gar wahr sind, dann ist auch ein Werkzeug wie Ask the Post AI wertlos.![]()
Zurück zur Startseite


Björn Brückerhoff
Prof. Dr. Björn Brückerhoff, geb. 1979, hat Neue Gegenwart® 1998 gegründet und ist Herausgeber, Chefredakteur und grafischer Gestalter des Magazins. Grimme Online Award- und Lead Awards-Preisträger.
Profil und Link zu allen Texten im Magazin seit 2003
Persönliche Website